Frontinus versorgte Köln täglich mit 20 Mio. Litern Eifelwasser
Autor: Harry Lindelauf
Fotografie: Wikimedia

Die Römer bauten ihre berühmten Aquädukte nicht nur in Rom. Überraschend vielleicht: Entlang der Via Belgica zwischen Köln und Tongern gibt es Aquädukte in Köln, Aachen, Heerlen, Voerendaal und Tongern. So fügt sich alles zusammen. Heute: Köln.
Frontinus versorgte Köln täglich mit 20 Millionen Litern Eifelwasser.
Ein Bote aus Rom bringt einen Brief des Kaisers. Das Klagen über Wassermangel in Köln soll enden. Ob man das bitte lösen könne — notfalls mit einem 95 km langen Aquädukt. Und zügig, versteht sich: Ein Kaiser braucht Freunde, keine Nörgler.
Der Empfänger ist Sextus Iulius Frontinus, Kommandeur der Garnison in Colonia Claudia Ara Agrippinensium am Beginn/Ende der Via Belgica. Er ist zugleich Statthalter — und praktischerweise Ingenieur.
Wasser aus dem Rhein? Nicht sauber genug
Bereits um 30 n. Chr. hatte Köln ein erstes Aquädukt. Die Stadt lag am Rhein, doch die Römer hielten dessen Wasser nicht für sauber genug. Um sicheres Trinkwasser zu gewährleisten, erschloss man fünf Quellen südwestlich der Stadt. Köln wuchs jedoch so stark, dass mehr Wasser nötig wurde. Also begann Frontinus um 80 n. Chr. mit seinem Großprojekt.

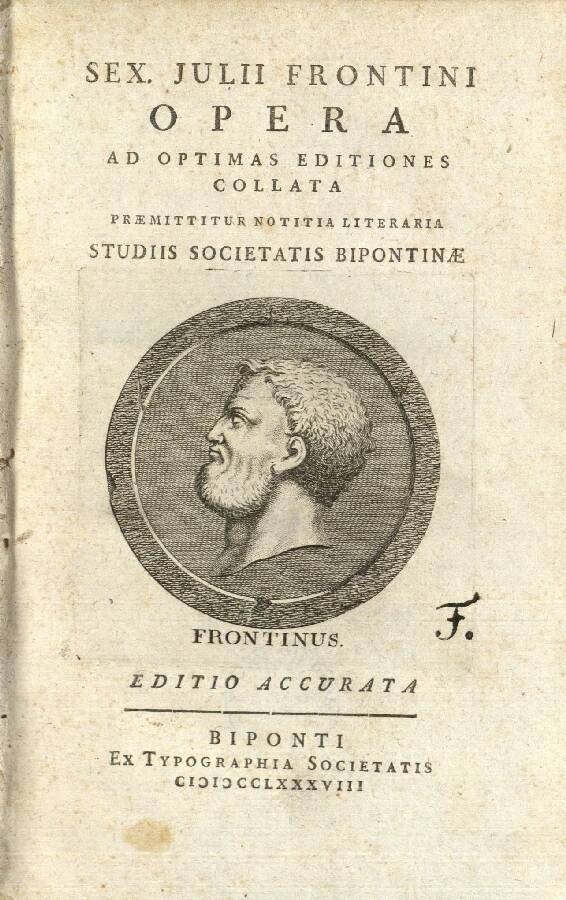
Das Vorgehen – Frontinus’ „Skillset“
1. Quellensuche: ergiebig, trinkbar, höher gelegen als die Stadt.
2. Vermessung & Trasse: exakte Geländestudien, Route mit minimalen Hindernissen und sehr geringem Gefälle.
3. Bau in Abschnitten von gut 4 km, parallel ausgeführt.
4. Ressourcen: Vermesser, Ingenieure und Tausende Legionäre aus Köln und Bonn, dazu Wagen, Ochsen, Ziegel, Naturstein, Zement.
5. Begleitstraße entlang der Trasse für Bau und späteren Unterhalt.
6. Städtische Netze parallel: gemauerte Kanäle und Bleileitungen in der Stadt.
Maastricht–’s-Hertogenbosch
Die Suche endete 95 km von Köln entfernt (etwa Maastricht–’s-Hertogenbosch), im Urfttal bei Nettersheim. Dort fand man Eifelquellwasser, mineralreich und besonders kalkhaltig. Hier begann das römische Aquädukt — mit 95,4 km das längste nördlich der Alpen.
Nach Fertigstellung flossen täglich 20 Millionen Liter kostbares, sauberes Wasser nach Köln. Ein Kraftakt, der auch nach fast 2.000 Jahren Staunen weckt.

2.500 Legionäre, 16 Monate
Berechnungen in Deutschland zeigen: pro Meter Aquädukt bewegten die Römer 3–4 m³ Erde, mauerten 1,5 m³ Wand und verputzten über 2 m². Rund 2.500 Legionäre waren 16 Monate beschäftigt — die extrem präzise Vermessung nicht mitgerechnet. Das Gefälle betrug 1 m auf 1.000 m (0,1 %), sodass die Leitung Köln 10 m über Bodenniveau erreichte — 80 m tiefer als die Quellen bei Nettersheim.
Wie sah das Aquädukt aus?
Vergiss das Bild hoher Bogenreihen wie am Pont du Gard. Das Kölner Aquädukt war ein gemauerter Kanal von ca. 70 cm Breite und 1 m Höhe. Er lag bis zu 1 m tief (frostsicher) im Boden. Der wasserdichte Betonkanal ruhte auf Steinfundamenten und war mit einem gemauerten Gewölbe abgedeckt, um Verunreinigung zu verhindern. Revisionsschächte dienten der Wartung; Absetzbecken sorgten für möglichst klares Wasser.

Baustoffe aus dem obersten Regal
Möglich wurde das durch römischen Beton: gelöschter oder ungelöschter Kalk mit Sand, kleinen Steinen oder zerkleinerten Dachziegeln, vulkanischer Asche und Wasser. Der Beton wurde in Schalungen gegossen; Brettabdrücke sind heute noch sichtbar.
In der Eifel waren Brückenbauwerke nötig, um Täler zu queren. Am größten war die Swisttal-Brücke zwischen Rheinbach und Lüftelberg: 1.400 m lang mit fast 300 Bögen. Bei Euskirchen gab es eine 500 m lange Brücke; weitere kleinere Bauwerke ergänzten die Trasse.
Von Beton und Naturstein zu Blei
In der Stadt endete das Aquädukt in einem Hochbehälter, von dem die Schwerkraft die Verteilung übernahm. Innerstädtisch nutzten die Römer Bleirohre und Bronzehähne. Das kalkreiche Eifelwasser bildete Ablagerungen in den Leitungen, die die Trinkenden vor der Giftigkeit des Bleis schützten. Die im Aquädukt gewachsenen Kalksinter wurden sogar als eine Art „Aquäduktmarmor“ wiederverwendet, u. a. für Säulen.

